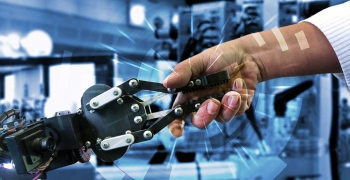Der globale Energiesektor hat derzeit mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Inmitten einer wachsenden Nachfrage nach einem Ausgleich zwischen der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und agilen digitalen Technologien durchläuft die Branche einen Übergang zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Die Auswirkungen werden durch die 5.500 Gigawatt (GW) an neuen Kapazitäten für erneuerbare Energienunterstrichen , die zwischen 2024 und 2030 prognostiziert werden - ein Anstieg von fast 300 Prozent im Vergleich zum Zeitraum zwischen 2017 und 2023.
Und das vor dem Hintergrund eines noch nie dagewesenen Kostendrucks und anhaltender geopolitischer Unsicherheiten.
Einstieg in die Digitalisierung
Die Digitalisierung hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem der wichtigsten Treiber im globalen Energiesektor entwickelt und ermöglicht beispiellose Chancen auf breiter Front. Die Kommoditisierung von IoT-Geräten, rasante Fortschritte bei Cloud-Technologien, erschwingliches Computing, der Aufstieg der offenen Automatisierung und die Einführung von KI, maschinellem Lernen und generativer KI (GenAI) sind einige der wichtigsten Trends, die den Energiesektor weiterhin neu definieren.
Heute ist die Rolle der Digitalisierung in jedem Aspekt des Geschäftsbetriebs offensichtlich. Von effizienten IT-Services, die durch automatisierte Helpdesks unterstützt werden, bis hin zur Erstellung kundenspezifischer Anwendungen mit nur wenigen Klicks (durch Low Code/No Code-Plattformen), Fernbetrieb und vorausschauende Wartung - digitale Tools verändern die Arbeitsweise globaler Energieunternehmen.
Interessanterweise haben sich die zentralen geschäftlichen Herausforderungen zwar nicht wesentlich verändert, aber die Komplexität dieser Herausforderungen, ihre gegenseitigen Abhängigkeiten und die Vorteile einer erfolgreichen Digitalisierung sind gestiegen. Zu den kritischen Geschäftsanforderungen gehören heute unter anderem:
- Sicherstellung der Geschäftskontinuität durch die Verfügbarkeit von Anlagen
- Optimierung von CAPEX und OPEX
- Verbesserung der Zuverlässigkeit der Anlagen und der Produktivität des Wartungsteams
- Gewährleistung eines sicheren Betriebs
- Ermöglichung von Fernbetrieb und Entscheidungsfindung in Echtzeit
Dennoch zeigen Studien, dass die Erfolgsquote von Programmen zur digitalen Transformation im Energiesektor mit 25 % bis 35 % nach wie vor gering ist. [Quelle: ISG Manufacturing Industry Survey und ARC Advisory Benchmarking Research]
Definition des Digitalisierungsweges
Bevor die Gründe für die niedrigen Erfolgsquoten untersucht werden, ist es wichtig, ein gemeinsames Verständnis von digitalen Begriffen zu haben. Es gibt viele miteinander verknüpfte und oft austauschbare Begriffe, wie z. B. digitale Programme, digitale Zwillinge, digitale Fäden, IT-OT-Integration und Digitalisierung.
Im Wesentlichen bezieht sich die Digitalisierung auf die Implementierung eines oder mehrerer digitaler Programme innerhalb eines Unternehmens. Diese Programme können vom Aufbau grundlegender Systeme wie der IT-OT-Integration bis hin zur Schaffung spezifischer Lösungen wie Digital Twins reichen. Digitale Zwillinge können verschiedenen Geschäftsfunktionen dienen, z. B. dem Engineering, der Echtzeitüberwachung von Anlagen, der Geodatenanalyse, der Simulation oder dem Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement (EHS). Ein Digitaler Zwilling ermöglicht es Unternehmen, Daten über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen oder Prozessen zu verfolgen.
Der wichtigste Aspekt der Digitalisierung ist die direkte Korrelation mit den geschäftlichen Auswirkungen und der Wertschöpfung.
Warum scheitern Digitalisierungsbemühungen immer noch?
Die Forschung zeigt mehrere Hindernisse für eine erfolgreiche Digitalisierung auf, darunter hohe Implementierungskosten, Qualifikationsdefizite, schlechte Datenqualität, eingeschränkte Interoperabilität, regulatorische Herausforderungen und Cybersicherheitsrisiken. [Quelle: ISG Manufacturing Industry Survey und ARC Advisory Benchmarking Research]. Einer der am häufigsten übersehenen Faktoren ist jedoch der menschliche Aspekt.
Der menschliche Faktor umfasst Fehlkommunikation, unzureichende Einbeziehung der Benutzer, Missverständnisse bei komplexen Sachverhalten, Widerstand gegen Veränderungen, mangelndes Vertrauen, unzureichende Schulungen und ineffektives Änderungsmanagement. Ironischerweise sind dieselben Faktoren, die herkömmliche Projekte oft verzögert oder zum Scheitern gebracht haben, auch für viele Fehlschläge bei der Digitalisierung verantwortlich.
Warum ist die Digitalisierung eine Priorität für Unternehmen?
Wie eingangs erwähnt, stehen im Energiesektor die Verringerung des Kohlendioxidausstoßes, die Umstellung auf grüne Energie, die Reduzierung der Ausfallzeiten von Anlagen und ein sicherer Betrieb ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Digitalisierung ist ein entscheidender Hebel, um diese strategischen Ziele zu erreichen.
So hat LTTS vor kurzem eine KI-basierte Echtzeit-Überwachungslösung (Konvergenz von IT-, OT- und ET-Datenströmen) für die kritischen Anlagen des Kunden (Kompressoren, Turbinen, Öfen, Wärmetauscher usw.) in großem Maßstab (mehr als 70 petrochemische Anlagen) implementiert und damit die ungeplanten Ausfallzeiten um mehr als 10 % reduziert. Da die Sicherheit einer Anlage bei plötzlichen Abschaltungen und Anläufen am stärksten gefährdet ist, wurde das potenzielle Risikoprofil durch den Einsatz erheblich reduziert.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der zunehmende Einsatz von offener Automatisierung, KI, generativer KI und anderen Technologien bereits Anwendungsfälle zum Leben erweckt, die noch vor wenigen Jahren weit hergeholt schienen.
IT-Abteilungen, die einst als Kostenstellen betrachtet wurden, nehmen nun eine geschäftsorientierte Denkweise an und erschließen sich Monetarisierungsmöglichkeiten. Unternehmen sind auf dem Weg zu den "Assets der Zukunft", die sich durch folgende Merkmale auszeichnen:
- Selbstheilungsfähigkeiten
- Selbst-optimierende Leistung
- Sicheren und zuverlässigen Betrieb
Die Entwicklung hin zu vollständig integrierten digitalen Anlagen ist in vollem Gange, und viele wichtige Komponenten sind bereits vorhanden. Allerdings müssen Faktoren wie das menschliche Element und die Cybersicherheit bei jedem Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung sorgfältig berücksichtigt werden.